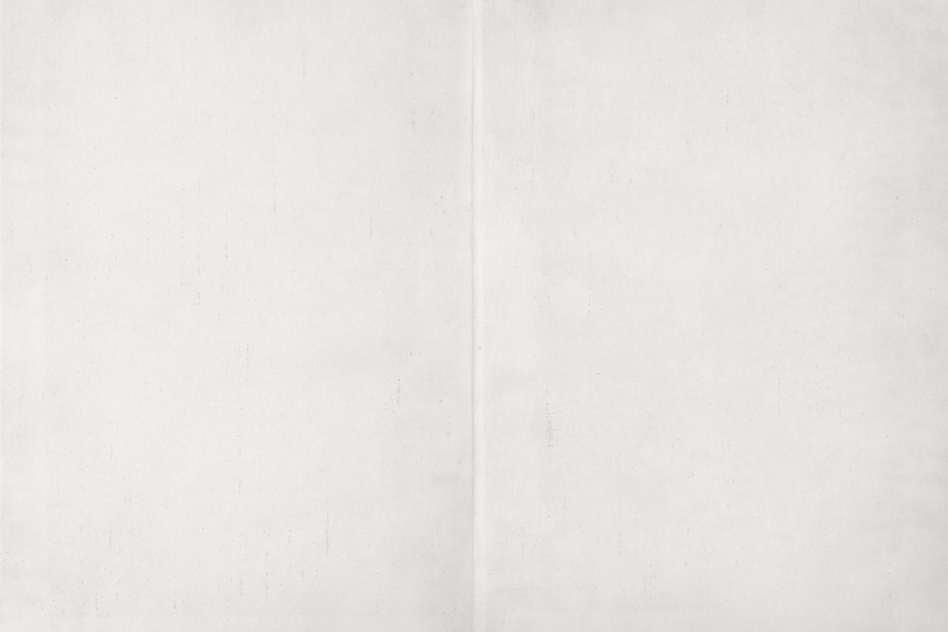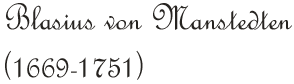Gelöst: Das Rätsel von Eulroda

Mit seiner apodiktischen Behauptung: »gibt es nich, hat es nie gegeben!« lag Pfauth am Tage unseres Kennenlernens gar nicht falsch. Auch gemeinsame Recherchen brachten nichts als staubige Finger und bronchiale Verstimmungen. Das änderte sich erst, als uns unter den in V* entdeckten Materialien ein fadengeheftes »Schreibebuch« (auf das Jahr 1708) in die Hände kam, in dem unser Held ein paar Worte über den Ort verlor, den er im Laufe seines langen Lebens einmal verlassen haben dürfte. Darin heißt es unter anderem:
»Eulroda, also genennet von Kindsbeinen an, weilln mich der Keutzlein unnd Eulen nächtlichs Treiben choraliter in Schlaf zu singen nie sich endigt, im tieffsten Walde umher ihr seltsamlich musica tönet unnd durch Liedlein vom Tode mir mancherley Ergetzlichkeyth bereidt«. Anderwärts heißt es: »müßte die [NB: deutsche] Meile nach E. allso behend gereitet sein, wie niemaln zuvor, mir die sehnlichst erwarteten Gäst von Suhle her zu vermelden«; und noch einmal: »wann um zwo Meilln herum den Berg bis St. Blasii zu Z[ella] sullt reiten, nähm ehr s Gefehrt unnd Stoffeln [NB: Christoph, den natürlichen Halbbruder]«. Auf Grund dieser Angaben ließ sich eine relativ überschaubare Gegend umreißen, die – da wir ja nach einem Flecken suchten, der landwirtschaftlich genutzt worden war – zwar in der Nähe eines Waldstücks, nicht aber innerhalb eines solchen gelegen sein konnte.
Ein letzter Schritt zur Wiederentdeckung des rätselhaften Eulroda (»nahe dem bekannteren Suhle«, BvM) war getan, als wir die zehn im V*.er Nachlaß erhaltenen Druckexemplare des Schäferspiels Friedrich unnd Gerlinde examinierten: Auf dem Vorsatzblatt eines Heftes hat ein unbekannter Schreiber notiert, daß das Stück »sehr zu Belustigung unnd allseitichter Freüdn unter Himmel von Eulroda gespielet worden den 10. Junius a.D, 1701 wobey ihm selbste den Friederich dargeboten, unnd hernacher, wie dem Unholt im Karpffenteiche seyn Schicksal ward, ihm wie von ohngefähr hinterdreyn geflogen unnds Schauspiel vorbey gewest mit plärrendem Gesang zugleich Geschrey vom Wasser her.«
Wenn wir also fündig werden wollten (immer vorausgesetzt, die einstigen »Besitzthümer« waren überhaupt noch vorhanden!), so mußten wir uns in einem recht überschaubaren Gelände bewegen. Vermutlich lag es nahe bei dem, nicht am im Walde, umgeben von einigem Weideland, auf dem womöglich noch immer einige Spuren an einen einstigen Tümpel oder Fischteich erinnerten. Und – man ahnt es beim Blick auf das obige Photo – dieses schöne Stückchen Erde gibt es tatsächlich. Es liegt ein wenig abseits des vordergründig zu sehenden Weges nach V* und wird beherrscht von einem offensichtlich über mehr als einhundert Jahre erweiterten Bauwerk, dessen älteste Schicht der alte Manstedten um 1650 erworben hatte. Daß wir an der richtigen Adresse angekommen waren, stellte sich schnell heraus: Die heutigen Besitzer und Bewirtschafter, eine sechsköpfige Familie namens F*nbarth [aus begreiflichen Gründen wollen wir sie diskret vor zu vieler Neugier schützen],hörten sich geduldig unsere Vermutungen an, ohne auch nur im mindesten von unserem Besuch überrascht zu sein. Im Gegenteil: »Irgendwann mußte das ja ma‘ passieren!« meinte Hermann F, der Vater unter Hinweis auf die verwickelte Geschichte ihres Anwesens, auf dem sie auch unter »volkseigener« Oberhoheit ihr Plansoll erfüllt hatten und jetzt, fünf Jahre nach dem Ende dieser Regie, wieder die Zügel in den Händen hielten. Hermann führte uns herum, zeigte uns mit verständlichem Stolz die historischen Stallungen, in denen – nur geringfügig modernisiert – noch immer einige der alten »Koben« ihren Dienst taten; wir betraten das ehemalige Wohngebäude, von dem aus eine schmale Treppe hinunter die entlegenen »Eisgewölbe«führt: »Hier, das Zeug steht schon seit Ewigkeiten da rum, hat mir mein Großvater schon erzählt. Bisher hat sich niemand außer uns hierher verirrt, wir können nischt damit anfangen, aber es sind da auch Bücher drinne und jede Menge alte Papiersachen. So was schmeißt man ja doch nicht weg – jedenfalls wir nich. Vielleicht können Sie ja was damit anfangen. Sie wissen ja, wo Sie uns finden. Ich laß Ihnen zwei Taschenlampen da,« gab der Hausherr noch drein, bevor er aus den auch sommers recht kühlen Gefilden verschwand.
Pfauth und ich ließen uns nicht lange bitten. Öffneten die erste daliegende Kiste. Und wußten, daß wir angekommen waren: Zahlreiche Bücher, am Ex libris unschwer zu identifizieren, dazu ordentlich gebündelte Papiere mit den uns inzwischen längst vertrauten Schriftzeichen – wo sonst, wenn nicht im ehemaligen Eulroda, heute Gemeinde V*, hätte all das wohl liegen sollen? Wir hatten den Nabel der Welt gefunden, in der Blasius von Manstedten König gewesen war.